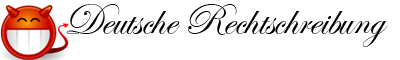Tag Archives: Adjektive
Klirrend kaltes Wetter
 In Europa ist es derzeit flächendeckend kalt. Sehr kalt. Ausgesprochen kalt. Am besten trifft es wohl: klirrend kalt. Da sich diese Beschreibung aufdrängte, als ich vorhin kurz mein wohlig warmes Büro verließ, dachte ich auch über die Rechtschreibung nach. Klirrend kalt schreibt sich in zwei Wörtern. Warum eigentlich?
In Europa ist es derzeit flächendeckend kalt. Sehr kalt. Ausgesprochen kalt. Am besten trifft es wohl: klirrend kalt. Da sich diese Beschreibung aufdrängte, als ich vorhin kurz mein wohlig warmes Büro verließ, dachte ich auch über die Rechtschreibung nach. Klirrend kalt schreibt sich in zwei Wörtern. Warum eigentlich?
Sehen wir uns an, mit welchen Wortarten wir es zu tun haben. An erster Stelle steht ein Partizip, konkret ein Partizip I, nämlich klirrend. An zweiter Stelle steht das Adjektiv kalt. Tun sich ein Partizip an erster Stelle und ein Adjektiv an zweiter Stelle zusammen, muss diese Verbindung immer getrennt geschrieben werden. Weitere Beispiele: gestochen scharf, brütend heiß, strahlend hell.
Ein anderes Adjektiv, das mir in Zusammenhang mit der derzeitigen Witterung einfällt, ist bitterkalt. Allerdings wird diese Verbindung zusammengeschrieben. Das liegt daran, dass in dieser Verbindung das Adjektiv kalt durch die Voranstellung des Adjektivs bitter intensiviert wird. Solche Verbindungen werden immer zusammengeschrieben. Weitere Beispiele: bitterböse, hochgiftig. Übrigens: Die Verbindung aus zwei so genannten gleichrangigen Adjektiven muss ebenso zusammengeschrieben werden, etwa nasskalt, taubstumm und schwarzweiß.
Abschließend noch eine meiner Lieblingsempfehlungen an jene, die viel elektronische Post bekommen und schreiben und durch eine Portion Kreativität auffallen möchten. Anstelle der doch schon sehr abgedroschenen Schlussformel mit freundlichen Grüßen empfiehlt sich eine an das Wetter, die Jahreszeit etc. angepasste Schlusszeile. Also etwa abendliche Grüße, vorweihnachtliche Grüße, sonnige Grüße oder eben klirrend kalte Grüße. Nach dieser Grußformel darf wohlgemerkt kein Komma und auch kein anderes Satzzeichen stehen.
In diesem Sinne freue ich mich, in den kommenden Tagen meinen Kamin auf Hochtouren zu beschäftigen. Heute Abend allerdings trotze ich der Kälte, um zur Buchpräsentation des von mir sehr geschätzten Daniel Glattauer zu gehen, der heute sein neues Buch „Ewig Dein” vorstellt. Die Veranstaltung ist restlos ausgebucht, weshalb es dort drin sicherlich alles andere als klirrend kalt sein wird.
Bitte nichts gutes zum Geburtstag wünschen
Mein (besser: unser, da Zwillingsschwester) Geburtstag ist zwar erst im Juni, aber ich stelle mich schon mal geistig darauf ein, gut gemeinte Glückwünsche à la *alles liebe zum Geburtstag zu bekommen. Es ist vielleicht fies von mir, aber solche Glückwünsche empfinde ich als ziemlich schmerzhaft.
Da die Groß- und Kleinschreibung stets für großes Fehlerpotenzial sorgt, hier eine Regel, die recht oft zur Anwendung kommt. Wenn vor einem Adjektiv (= Eigenschaftswort) eines der folgenden Wörter steht, gilt das Adjektiv als substantiviert und muss großgeschrieben werden: allerlei, alles, etwas, genug, nichts, viel, wenig.
Ein paar Beispiele gefällig?
Am ersten Schultag ist allerlei Erfreuliches passiert.
Ich habe etwas Spannendes zu berichten.
Sie hat schon genug Ärgerliches erlebt.
Das ist nichts Neues.
Und natürlich der Klassiker: Alles Gute zum Geburtstag! Oder: Alles Liebe zum Geburtstag!
Starke und schwache Deklination von Adjektiven
In Texten rund um die deutsche Rechtschreibung wird oft mit Begriffen wie „schwache“ und „starke“ Deklination jongliert. Das Problem dabei ist, dass kaum eine Muttersprachlerin weiß, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Deutschlernende hingegen machen schon sehr früh leidvolle Erfahrungen mit diesem besonders schwierigen Kapitel der deutschen Sprache.
Schon mal darüber gegrübelt, warum man „schöner Tag“, aber „der schöne Tag“ sagt? Wenn ja, dann willkommen in der Welt der schwachen und starken Deklination. Wer sich ein wenig darin vertieft, wird heilfroh sein, Deutsch als Muttersprache zu haben.
Hier ein kurzer Überblick über die starke und schwache Deklination bei Adjektiven, die es übrigens auch bei Substantiven gibt. Bei Verben ebenso, aber da heißt sie bekanntlich Konjugation. Dann gibt es da noch die gemischte Deklination, aber das lassen wir mal beiseite. Ist so schon kompliziert genug.
Die starke Deklination wird verwendet, wenn kein Artikelwort vorausgeht. Hier der Einfachheit halber nur die männlichen Formen.
Nominativ: weich-er Stoff
Genitiv: (statt) weich-en Stoff[e]s
Dativ: (aus) weich-em Stoff
Akkusativ: (für) weich-en Stoff
Und hier die schwache Deklination des Adjektivs, die nach bestimmten Artikeln oder anderen Artikelwörtern verwendet wird:
Nominativ: der weich-e Stoff
Genitiv: des weich-en Stoff[e]s
Dativ: dem weich-en Stoff
Akkusativ: den weich-en Stoff
Mein Respekt gilt denjenigen, die das auswendig lernen müssen …
„Durch dick und dünn“, aber „Groß und Klein“
Wie am Freitag angedroht, nun ein Beitrag über noch schwierigere Fälle der Groß- und Kleinschreibung von Adjektiven (also Eigenschaftswörtern). Ich persönlich finde gerade diese Fälle nicht besonders logisch, aber was soll’s. Da hilft wohl nur noch eins: auswendig lernen!
Nicht deklinierte Adjektive in festen adverbialen Verbindungen mit Präposition werden kleingeschrieben. Das sind also Eigenschaftswörter, die in ihrer Grundform angeführt werden (dick, dünn, kurz, lang etc.) und denen eine Präposition voransteht (von, über, auf etc.):
durch dick und dünn, über kurz oder lang, von klein auf, von nah und fern, auf stur schalten
Nicht deklinierte Adjektive in substantivisch verwendeten Paarformeln wiederum werden großgeschrieben, sofern sie auch ohne Präposition stehen können:
Jung und Alt, Arm und Reich, Groß und Klein, Gleich und Gleich, Hoch und Niedrig, Gut und Böse
Wem das willkürlich erscheint: Das sehe ich auch so. Ich habe versucht, eine Logik dahinter zu suchen und zu verstehen, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Die Erklärung, dass Paarformeln solche sind, die auch ohne Präposition stehen können, erscheint mir, ehrlich gesagt, etwas konstruiert. Auch die substantivische Verwendung finde ich willkürlich angesetzt, weil man durch dick und dünn ebenso als substantivisch verwendet verstehen könnte wie Groß und Klein. Und schließlich schreibt man das Adjektiv trocken bei auf dem Trockenen sitzen ja auch groß. Dabei handelt es sich zwar um ein dekliniertes Adjektiv, aber warum muss krampfhaft unterschieden werden? Das hätte wirklich einfacher gestaltet werden können … schade!